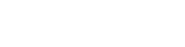Un, dos, tres, Marias – oder doch nur eine?
20.10.2019 | So sehr der Paarungstrieb das Überleben aller Spezies sichert, so sehr verkürzt dieser tendenziell die Lebensdauer von deren Individuen. Doch eine völlige Abstinenz scheint auch nicht der Wahrheit letzter Schluss, wenn man lange leben will.
So hält man sich schon mal die plärrende Blage vom Leib. (Quelle: flickr)[1]Das Leben eines/einer Schürzenjäger/in ist stressig. Die Paarungsbemühungen erfordern allen zivilisatorischen Bändigungen zum Trotz der Präsentation eigener Vorzüge, wenn nicht des Imponiergehabens und nicht selten noch der Konkurrenzkämpfe, die beiderlei Geschlechter in Anspruch nehmen können. Rasende Vollidtioten der männlichen Spezies oder volltrunkene Schnapsdrosseln, die damit auf obskure Weise bei jemanden die Attraktivität steigern wollen, sind bei den niederen Schichten wie auch in besseren Klassen durchaus keine Mangelerscheinung.
Mögen Investitionen in Attraktivität, die durchaus einen gesünderen Lebenswandel begünstigen können, teilweise gesundheitsdienlich sein, so sind doch die negativen Effekte eklatant überwiegend. Nebst dem stressgetriebenen selbstgefährdendem Verhalten schlägt der steigende Spiegel von Stress- und Sexualhormonen auch anderorts negativ zu Buche, wie bei der wahrscheinlich beschleunigten Thymus-Rückbildung. Noch schwerer wiegt die erhöhte Krebsgefahr, die logischerweise auch bei einer Hormonersatztherapie für im wahrsten Sinne des Wortes abschlaffenden Mid-Lifies hinlänglich zubuche schlägt.
Die aktive Sexpraktik ist überdies eine direkte Sterbeursache zumindet bei älteren Männern. Immerhin weden Männer nicht wie bei der Spinnengattung Schwarze Witwe vom Weibchen aufgefressen (besonders bei der Gattung Latrodectus hasselti), fallen aber ähnlich zur australischen Breitfuß-Beutelmaus schon mal vom Paarungsreigen erschöpft tot vom Ast (im übertragendem Sinne). Für Frauen sind Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen nach wie vor ein unschöner „Nebeneffekt“ der sexuellen Fortpflanzung. Umgekehrt senkt die Vaterschaft den Testosteronspiegel, wie auch bereits die feste Partnerschaft, die mit vertrauten Kuscheleinheiten für einen sicherlich gesundheitsförderlichen Wohlfühlfaktor sorgt.
Kinder sind wiederum ein Stressfaktor, wovon allein die nervraubenden SchreihälsInnen zur nächtlichen Unzeit zeugen. Anderseits wächst mit dem Nachwuchs die Erfüllung, wenn die „eigenen Gene“ prächtig gedeihen und das Fähnlein der rumreichen (oder ruhmlosen) Vorfahren auch künftig in den Äther halten. Auch sind Kinder, sofern nicht durchs Handy vorzeitig vor den Eltern dement geworden, eine reele und finanzielle Stütze im Alter.
So eindeutig ist es also nicht mit den Nachteilen der Sexualität, wie es auf den ersten Blick scheint. Der goldene Mittelweg scheint die gute alte monogame Ehe nach ein paar Jahren des Ausprobierens zu sein. Eine tieferschürende Argumentation scheint auch fehl am Platze, denn epidemiologische Erhebungen weisen auf die Ehe als die ideale Lebensform im Hinblick auf das Sexualverhalten im Kontext der Gesundheit hin. Ob ein abenteuerlicher Zwischenhappen nützt oder schadet, steht auf einem anderen, wohl nicht so schnell erforschten Blatt Papier.